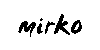
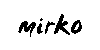
4. Der Spielmacher
Zunächst zu der angekündigten, in diesem Falle fast
überflüssigen und deshalb kurz gehaltenen Beweisführung. André Ehrl-König
hat im Roman eine eigene Fernsehsendung: die Sprechstunde. Das
realistische Vorbild ist hier das Literarische Quartett. Ferner weist
Ehrl-König exakt dieselben Spracheigentümlichkeiten auf, die auch Marcel
Reich-Ranicki aufweist. Es gibt noch viele weitere Anhaltspunkte, aber diese dürften
genügen.
André Ehrl-König wird dem Leser als eine Art
Spielmacher des Literaturbetriebes vorgestellt. Er ist der Mittelpunkt der
gesamten Szene und aus ihr nicht mehr wegzudenken. So weit, so korrekt. Doch die
Charakterisierung der literarischen Figur André
Ehrl-König ist unheimlich einseitig geraten. Ehrl-König wird beschrieben als
eitel, geschwätzig, selbstgefällig, undifferenziert, publicitysüchtig,
sexbesessen, arrogant, skrupellos, hinterhältig und unverletzbar. Er existiert
nicht, um der deutschen Literatur zu dienen, wie er gern vorgibt, sondern in
Wahrheit benutzt er die deutsche Literatur zur Mehrung seines Ruhmes. Dazu ist
ihm jedes Mittel recht, besonders seichte Bemerkungen. Ehrl-König ist
temperamentvoll, aber kein Intellektueller. Vielmehr ist er ein "inhaltsloses
Großtemperament, das auf Stichworte wartet".
[1]
Die liefert ihm Rainer Heiner Henkel, sein Mentor, der ihn sozusagen erschaffen
hat. Ehrl-König ist also auch noch das Geschöpf eines Anderen. Seine Urteile
sind denen eines Scharfrichters ähnlich: Bücher sind gut oder schlecht
– dazwischen gibt es nichts. Er urteilt auch nicht aufgrund angestrengter
Auseinandersetzung mit der Lektüre, sondern anhand von oberflächlichen
Kriterien. Seine Urteile sind seicht, extrem subjektiven Kriterien unterworfen
und kommerziell vermarktbar, was ihm zum Star in einer Mediengesellschaft wie
der Unsrigen geradezu prädestiniert.
Positive Eigenschaften? Fehlanzeige! Zwar hatte Hans
Lach einige Wochen vor der ominösen Sprechstunde bei einem Empfang in
der Villa Ludwig Pilgrims ein vertrauliches Gespräch mit Ehrl-König. Zwar
schrieb Ehrl König Hans Lach Jahr für Jahr französische Widmungen in seine (Ehrl-Königs)
Bücher und steckte sie ihm in den Briefkasten – doch auch dies war nichts als
Mache, nicht von ehrlichen Gefühlen geleitet.
Neben der Einseitigkeit der Charakterisierung Ehrl-Königs
fallen zwei weitere Punkte unangenehm auf. Zum einen wird der Literaturkritiker
nur in einer einzigen Szene während der Ausübung seiner Tätigkeit vorgeführt.
Diese Szene allerdings, dies muss gewürdigt werden, ist wunderbar gelungen.
Ein herrliches Stück Satire! Die Mittel mit denen
Ehrl-König in seiner Show Sprechstunde das neueste Buch Hans Lachs
verreißt, haben nichts mit seriöser Literaturkritik zu tun. So ist eines der
Kriterien Ehrl-Königs, "daß ein Roman, der mehr als vierhundert Seiten lang
sei, ihm, dem Leser André Ehrl-König, zu beweisen habe, warum er mehr als
vierhundert Seiten lang sein müsse".
[2]
Diesen Beweis tritt Lach laut Ehrl-König aber gar nicht an. Außerdem sei die
Protagonistin des Buches eine beschränkte Person. Begründungen werden
nicht geliefert. Aus dem Buch werden allenfalls Brocken zitiert, um sie leicht
verdaulich für das Studio- und Fernsehpublikum zu Zoten zu verarbeiten. Über
die Handlung des Romans erfährt man fast nichts. Dafür dient Überraschungsgast
Martha, die das Buch zu allem Überfluss gar nicht gelesen hat, als Nickdackel,
und steigert so die Wirkung der Ehrl-Königschen Worte. Doch das alles wirkt
hohl und den Leser beschleicht das Gefühl, gerade die Schilderung einer
drittklassigen Talkshow zu erleben. Seichte Sprüche, als Argumente getarnt,
sollen die Inhaltslosigkeit und Belanglosigkeit des Schauspiels überdecken.
Nach dieser Würdigung nun zum zweiten Kritikpunkt:
Walser beschäftigt sich teilweise
auf plattestem Niveau mit Dingen, die meiner Meinung nach überhaupt nichts mit
dem Thema zu tun haben. Drei Zitate mögen als Beispiele dienen:
"Nehmen Sie Ehrl-König und die Frauen. Es hat sich
nie um Frauen gehandelt, immer um Mädels. Oder auch um Mädelchen, da hat er
immer scharf unterschieden. Am liebsten waren ihm natürlich Mädelchen, aber
wenn's keine gab, nahm er auch Mädels. Frauen findet er langweilig. Unzumutbar.
Besonders deutsche. Weibliches plus Schicksal, zum Davonlaufen. Aber
schicksalslose, ihres Aufblühens noch nicht ganz sichere Mädelchen, dann wisse
er, sagte er, wozu er zur Welt gekommen sei. Herr Pilgrim musste ihm jede
auftauchende Literaturjungfer sofort melden. Und er fragte nie: Schreibt sie
gut, sondern: Ist sie hübsch."
[3]
"Lucie B., seit Jahren Ehrl-Königs Lektorin,
beklagt sich bei Ludwig. Sie kann nicht mehr. Seit einundzwanzig Jahren zwingt
Ehrl-König sie zu Komplimenten. Er lobt jedes Manuskript, das er bringt, und es
ist klar, dass sie zustimmen, sein Lob überbieten muß, oder er haßt sie.
Damit kann sie leben. Aber jetzt verlangt er, dass sie jedes Mal auch seine früheren
Bücher andauernd lobe. Das gehe zu weit. Sie weiß, dass seine Mutter ihn
abgelehnt hat, weil er klein und hässlich war. Dafür will er jetzt von jedem
andauernd entschädigt werden. Er ist ein Kind geblieben, das eine liebere
Mutter sucht, als es hatte. Aber sie weigert sich, diese Mutter zu sein. Ludwig
Pilgrim soll helfen."
[4]
"Sie habe einmal im Scherz gesagt, sie werde das
Geheimnis seiner Schuhe der Presse verraten. Er habe seine Schuhe immer in
Antwerpen produzieren lassen, die seien innen so gestaltet, dass er in diesen
Schuhen zweieinhalb Zentimeter größer gewesen sei als in Wirklichkeit. Der
Antwerpener Schuhmacher arbeitet hauptsächlich für Politiker und für
Gangster. Aber inzwischen sei dieses Geheimnis leider schon durch die RHH-Sippe
verplaudert worden. Sie habe noch eins in petto gehabt. Seine unbremsbare
Ejakulation. Also, er ist die Nullbefriedigung schlechthin. Und zwar immer schon
und immer noch – Wenn du das verrätst, habe er nach ihrer Andeutung gesagt,
wirst du nicht überleben."
[5]
Derlei quälende Stellen gibt es viele im Roman. Aber
warum nur? Was hat das alles mit dem Gegenstand zu tun, den Walser behandelt? In
solchen Szenen wirkt es für den Leser, als habe Walser im Affekt geschrieben.
Sein Angriff ist nicht auf den Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki beschränkt.
Er geht weit darüber hinaus und erstreckt sich auf den Menschen Marcel
Reich-Ranicki. Das muss man Walser vorwerfen. Weniger wäre hier deutlich mehr
gewesen. Denn durch Stellen wie die eben zitierten tritt die Kritik am
Literaturpapst Reich-Ranicki in den Hintergrund und verliert gewaltig an
Wirkung.
Zurück | Weiter | Kritisieren & Diskutieren | Mail | About Mirko
____________________
[1] Martin Walser: Tod eines Kritikers. S. 148
[2] Martin Walser: Tod eines Kritikers. S. 38
[3] Martin Walser: Tod eines Kritikers. S. 111f.
[4] Martin Walser: Tod eines Kritikers. S. 71f.
[5] Martin Walser: Tod eines Kritikers. S. 173f.