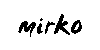
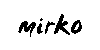
3. Zur Konstruktion des Romans
Walser hat diesen Roman so konstruiert, dass die Geschehnisse der ersten beiden Kapitel
sich in der Realität niemals genau so hätten abspielen können. Der Ich-Erzähler
Michael Landolf ist nämlich keine real existierende Person, sondern das Alter
Ego (und Pseudonym) von Hans Lach. Im dritten und letzten Kapitel des Buches
bekennt Hans Lach: "Michael Landolf, ich danke dir dafür, dass du mir
Unterschlupf gewährt hast. Und ziehe aus. Scheinbewegungen sind das. Erzähler
und Erzählter sind eins. Sowieso und immer. Und wenn der eine sich vermummen
muss, um sagen zu können, wie der andere sich schämt, so ist das nichts als
das gewöhnliche Ermöglichungstheater, dessen jede menschliche Äußerung
bedarf. Glaube ich. Wer auch immer das sei."
[1]
Die eigentliche Story wird in den ersten beiden Kapiteln erzählt. Das dritte
Kapitel schildert hauptsächlich den fünfmonatigen Aufenthalt von Hans Lach und
Julia Pelz-Pilgrim, der Gattin Ludwig Pilgrims, auf Fuerteventura. Nachdem die
Beiden zurückgekehrt sind, reist Hans Lach allein nach Klais. In der dortigen
Abgeschiedenheit will er sich etwas von der Seele schreiben. Er beginnt mit
folgendem Satz: "Da man von mir, was zu schreiben ich mich jetzt veranlasst fühle,
nicht erwartet, muss ich wohl mitteilen, warum ich mich einmische in ein
Geschehen, dass auch ohne meine Einmischung schon öffentlich genug geworden zu
sein scheint."
[2]
Dies ist der letzte Satz des Romans. Es ist aber gleichzeitig auch der erste
Satz des Romans, mit dem Michael Landolf seine Erzählung eröffnet.
Somit kann der Aufbau des Romans folgendermaßen beschrieben werden: Der
Schriftsteller Hans Lach schreibt unter dem Pseudonym und aus der Sicht seines
Alter Egos Michael Landolf eine Geschichte über Machtausübung im
Literaturbetrieb. Dieses Geschichte umfasst die ersten beiden Kapitel des
Buches, in denen Michael Landolf als Ermittler und Hans Lach als Mordverdächtiger
auftreten. Im dritten Kapitel leidet Hans Lach, der sich inzwischen seines Alter
Egos und Pseudonyms Michael Landolf entledigt hat, zunächst unter den
Auswirkungen der von Michael Landolf erzählten Geschehnisse bis er, mit maßgeblicher
Hilfe von Julia Pelz-Pilgrim, die Kraft findet, sich sein Leiden von der Seele
zu schreiben. Allerdings existiert auch im dritten Kapitel keine saubere
Trennung zwischen Hans Lach und Michael Landolf. So führt Lach beispielsweise
das Projekt Von Seuse zu Nietzsche des Mystikforschers Landolf wie
selbstverständlich fort.
Warum hat Walser diesen Roman so konstruiert? Was bringt ihm dieser Aufbau? Um diese
Fragen beantworten zu können, muss zuerst das Versteckspiel um die Figuren
aufgegeben werden. Denn Walser hat, möge er sich auch noch so sehr dagegen
wehren, einen Schlüsselroman vorgelegt. Viele Figuren haben reale Vorbilder und
werden auf (meist satirische) Weise porträtiert. In der Figur des André
Ehrl-Koenig erkennt der Leser überdeutlich, weil stark überzeichnet, Marcel
Reich-Ranicki wieder. Und vieles spricht dafür, dass Martin Walser sich selbst
mit der Figur des Hans Lach porträtiert. Die Beweisführung verschiebe ich auf
die nächsten beiden Kapitel. Gesetzt den Fall, diese Behauptungen treffen zu,
so lautet die nächstliegende Antwort auf die oben gestellten Fragen: Die von
Walser gewählte Konstruktion ermöglicht es ihm im Rahmen seines Themas von
seinem persönlichen Leiden zu erzählen. Sie ermöglicht es ihm Betrachter und
Betrachteter gleichzeitig, ja ein Betroffener zu sein, der mit Objektivitätsanspruch
von seinem Fall als Präzedenzfall berichtet. Und
zwar, deshalb der Kunstgriff mit Michael Landolf, indem er quasi aus sich selbst
heraustritt und sein Leiden betrachten lässt. Das Lehrstück, das Walser gerne
aufführen möchte, handelt von der Machtausübung im Literaturbetrieb und von
den Konsequenzen dieser Machtausübung für die Betroffenen. Walser stellt, um
die Lehre zu transportieren, seinen eigenen Fall ins Schaufenster. Derjenige,
der Macht ausübt, ist Marcel Reich-Ranicki. Der von dieser Machtauübung Ge-
und Betroffene ist – neben anderen – Martin Walser. Ohne den Kunstgriff mit
Michael Landolf wären Walser zwar viele weitere Möglichkeiten geblieben, den
Stoff zu transportieren. Ein real existierender Ich-Erzähler von der ersten bis
zur letzten Sekunde etwa oder die Einführung eines Freundes als Erzähler.
Walser hätte auch von seinem persönlichen Schicksal abstrahieren können. Sein
Fall muss ja nicht als Beispiel für die Branche dienen.
Allerdings: Einen Ich-Erzähler von der ersten bis zur
letzten Sekunde hätte man Walser nicht abgenommen. Das hätte zu penetrant
gewirkt. Ein Freund als Erzähler hätte unauflösbare Distanz zur Figur Hans
Lachs bewirkt. Aber ein Freund Hans Lachs, der Hans Lach selbst ist, kann zu
jeder Sekunde beides transportieren: Lehrstück und persönliches Schicksal.
Hinweisen möchte ich in diesem Zusammenhang auch noch
einmal auf den identischen Anfangs- und Schlusssatz des Romans. Wer das Buch
beendet hat, landet wieder beim Anfang. Die Geschichte ist niemals
abgeschlossen, die Machtausübung niemals vorbei. Sie wiederholt sich immer und
immer wieder mit klar verteilten Rollen. Der Starkritiker hat die Macht auf
seiner Seite und gewinnt. Der Schriftsteller ist von der Macht des Starkritikers
abhängig und kann aus eigener Kraft nicht gewinnen.
Zurück | Weiter | Kritisieren & Diskutieren | Mail | About Mirko
____________________
[1] Martin Walser: Tod eines Kritikers. S. 188. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 2002
[2] Martin Walser: Tod eines Kritikers. S. 9