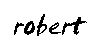
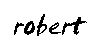
"Der Proceß" als Spiegel Freudscher Persönlichkeitskonflikte
- Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er
etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.[1]
- "Wie ein Hund!" sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben.[2]
Am
26. April 1925 erschien im Berliner Verlag Die Schmiede Franz Kafkas Fragment
gebliebener Roman "Der Proceß" in einer Auflage von etwa 450 Exemplaren. Möglich
war dies nur, weil Max Brod den letzten Willen des im Vorjahr verstorbenen
Freundes Kafka missachtete, dessen unveröffentlichten Manuskripte zu
vernichten. Soweit lässt sich die Veröffentlichungsgeschichte des Buches
belegen. Warum aber Kafka "Der Proceß" zu Lebzeiten und auch danach nicht
veröffentlicht sehen wollte, lässt sich nicht mit Eindeutigkeit ermitteln.
Seine letzte Bitte an Max Brod gibt keine Anhaltspunkte für seine Motive, und
so sind wir auf Spekulationen angewiesen.
Der Roman handelt von dem dreißigjährigen Bankangestellten Josef K., der eines Morgens Besuch erhält von zwei Herren, die ihn zunächst in Arrest nehmen und ihm mitteilen, dass ein Prozess gegen ihn anhängig ist. Im folgenden Jahr versucht K. das Verfahren gegen ihn zu seinen Gunsten zu beeinflussen, ohne dabei jemals sein Vergehen zu erfahren oder irgendeinen Erfolg zu erreichen. Schließlich wird K. am Vorabend seines einunddreißigsten Geburtstages wiederum von zwei Herren abgeführt und in einem Steinbruch hingerichtet.
Auffällig ist besonders die surreale Atmosphäre des Buches. Nicht nur der gesamte Prozessverlauf, auch die Abhaltung der Gerichtssitzung in einem Hinterhauswohnzimmer oder die auf einem Dachboden beheimateten Anwaltskanzleien, lassen einen vermuten, dass diese Geschichte nicht in der Alltagswelt spielen kann. Wahrscheinlicher erscheint einem da schon eine Traumwelt, in der die Gesetze der Logik und Konvention außer Kraft gesetzt sind. Nicht unmöglich ist die Vorstellung, dass es sich bei dem Romangeschehen um die alptraumhafte Verarbeitung von Josef K.s dreißigstem Geburtstag handelt; solche Brüche im Leben eines Menschen sind empirisch gesehen prädestiniert für metaphysische Sinnkrisen. Allerdings scheint mir die Idee, "Der Proceß" schildere stattdessen eine Nahtoderfahrung wenn auch nicht naheliegender, so doch reizvoller.
In der abendländischen Kultur ist die Vorstellung eines Gerichthaltens nach dem Tode verbreitet. Nun will ich nicht behaupten, dass uns nach unserem Ableben tatsächlich ein nicht-weltliches Gericht erwartet; eine solche Vorstellung liegt mir als Atheisten fern. Vielmehr verhält es sich so, dass Josef K., der unzweifelhaft von genannter abendländischer Kultur geprägt ist, durch sein Unbewusstes eine solche Gerichtssituation imaginiert.
Für diese Annahme spricht die Tatsache, dass K. keinem nachweltlichem Richter gegenübersteht, der sein Handeln auf Erden beurteilt und ihm ein jenseitiges Schicksal zuweist. Der Plot enthält, wie für einen Traum typisch, viele realitätsbezogene Aspekte. Diese sind sogar so stark, dass K. glaubt, sich noch immer in seiner Alltagswelt zu befinden, die nur zunehmend von bizarren Ereignissen infiltriert wird. Es wäre somit durchaus valide zu behaupten das ganze geschilderte Geschehen spiele sich innerhalb von K.s Selbst ab.
Folglich wären alle Personen, denen K. im Laufe der Handlung begegnet, lediglich projizierte Teile seiner Person, wenngleich K. sie nicht als solche wahrnimmt. Laut Psychoanalyse ist die Projektion eigener unerwünschter Verhaltensweisen auf andere Personen eine typische Abwehrreaktion. K.s Ablehnung bestimmter Triebe ist so stark, dass er diese nicht nur auf andere projiziert, sondern sogar die Anderen zum Zwecke der Projektion erschafft. Dass es für einige der Figuren ‚reale’ Vorbilder gibt, wie etwa die Hauswirtin Frau Grubach oder die Nachbarin Fräulein Bürstner, ist möglich.
Laut Freudscher Theorie, eines zur Zeit der Entstehung des Romans hochaktuellen und provokanten Ansatzes, spaltet sich die Persönlichkeit eines Menschen, sein Selbst, in drei Instanzen: Das von Geburt an vorhandene Es ist der Sitz der primitiven Triebe und Motive (vor allem von Sex und Aggression, aber auch von Hunger oder Selbsterhaltung) und drängt auf Trieberfüllung ohne Rücksicht auf Logik oder Konsequenzen. Im Laufe der Sozialisation formt sich das Über-Ich, die Verinnerlichung der gesellschaftlichen Werte und Normen. Zwischen diesen beiden Gegenspielern vermittelt das Ich. Seine synthetische Funktion erlaubt die Anpassung der widersprüchlichen inneren Bedürfnisse an die Realität.
Bei K. ist durch die repressive Gesellschaftsnorm das Über-Ich besonders machtvoll. Die Unterdrückung der Triebe lässt aber auch das Es revoltieren, und so scheint K.s Ich nicht in der Lage die Konflikte zwischen den starken Kontrahenten zu lösen, geschweige denn sie als Teil des Selbst zu akzeptieren und erschafft sie daher als äußere Bedrohung durch Andere.
Zumeist vereinigen diese Anderen Aspekte von Über-Ich und Es in sich (wobei sie natürlich auch weiterhin Teil von K.s Person sind). Fräulein Bürstner etwa ist sowohl das strafende Über-Ich ("..., und dass wäre mir unseretwegen noch unangenehmer als der Leute wegen."[3], "... dass ich gezwungen bin, Ihnen etwas zu verbieten, was sie sich selbst verbieten mussten"), als auch Personifikation der Neugier ("Ich bin wirklich neugierig.", "..., denn ich möchte alles wissen, und gerade Gerichtssachen interessieren mich ungemein."). Mit keiner der Personen ist K. jedoch in der Lage zusammenzuarbeiten, um einen Vorteil für seinen Prozess zu erwirken. Stattdessen glaubt er nach jeder Begegnung, dass die Nicht-Kooperation vorteilhafter sei und verurteilt die anderen Personen, ob ihrer Schwächen. Er erkennt nicht, dass sein unbekanntes Vergehen darin besteht, diese Konflikte mit seiner eigenen Persönlichkeit nicht lösen zu können. Er wird, indem er die anderen verurteilt, auch sein eigener Richter und verdammt sich somit selbst.
Besonders
auffällig ist, dass der Prozess beginnt als K. von zwei Wächtern
verhaftet wird und damit endet, dass er von zwei Henkern hingerichtet
wird. Hier treten Über-Ich und Es getrennt auf, quasi als Alpha und Omega des
Konfliktes. Während einer der Wächter K.s Frühstück isst (Hunger als Primärtrieb
und Repräsentant des Es), wird vom letzteren gesagt er "überragte K.
bedeutend"[4]
(er steht für das Ich-Ideal, den Teil des Über-Ich, der die überlebensgroße
Wunschvorstellung der eigenen Person darstellt). Auch am Ende weiß K. nicht wie
sehr er von den beiden Persönlichkeitsinstanzen beherrscht wird und sieht die
Henker als "untergeordnete Schauspieler"[5],
zweitrangige Akteure auf der Bühne des Selbst.
Als er schließlich einwilligt mit ihnen mitzugehen, scheint eine Lösung
doch noch möglich. "... sie bildeten jetzt eine Einheit, dass, wenn man einen
von ihnen zerschlagen hätte, alle zerschlagen gewesen wären."[5]
Da K. zum ersten Mal Über-Ich und Es akzeptiert, scheint es sogar möglich sich
ihrer zu erwehren. Er bleibt stehen und widersteht dem Versuch der Henker ihn
wegzuzerren. Beim Auftauchen einer Frau wird K. jedoch geschwächt und
Über-Ich und Es gelingt es K. durch amouröse Triebe einerseits und die
Angst sich zu blamieren andererseits, zu überwältigen. Sie führen ihn weg und
vollstrecken das selbstverhängte Todesurteil.
Im Gegensatz zu K. hat Kafka vielleicht den Zweikampf innerhalb seines Selbst erkannt und sich davon befreit, indem er "Der Proceß" schrieb. Vieles spricht dafür, dass die Figur des Josef K. an Kafka angelehnt ist. Auch dieser war zu der Zeit als er den Roman um 1914 verfasste dreißig Jahre alt und wofür steht K. wenn nicht Kafka? Möglicherweise war das Werk zu persönlich, um es zu veröffentlichen und Kafka wollte es darum vernichtet wissen. Und wenn Josef K. sterben musste, damit Kafka leben konnte, so musste Kafka sterben, dass "Der Proceß" noch heute lebt.
Zurück | Kritisieren & Diskutieren | Mail | About Robert
______________
[1] Kafka, Franz: Der Proceß. Erstes Kapitel, erster Satz
[2] Kafka, Franz: Der Proceß. Zehntes Kapitel, letzter Satz
[3] alle Zitate Fräulein Bürstner betreffend aus dem ersten Kapitel
[4] Erstes Kapitel
[5] Letztes Kapitel