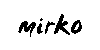
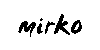
1. Niklas Luhmann contra Jürgen Habermas -
die Habermas-Luhmann-Kontroverse
1971 erschien
die Systemtheorie von Niklas Luhmann.
Luhmann erhob damit als erster Soziologe der Nachkriegsgeschichte den Anspruch
eine gesamtgesellschaftliche Theorie entwickelt zu haben, die sich auf alles und
jedes menschliche gesellschaftliche Handeln und jede Gesellschaft anwenden ließe.
Also keine Theorie einer Bindestrich-Soziologie, eines vorher fest abgegrenzten
Teilbereiches wie Organisations-Soziologie oder Kommunikations-Soziologie, in
welcher per Definition bestimmtes gesellschaftliches Handeln (in der
Organisations-Soziologie zum Beispiel vorrausschauendes, nicht-affektuelles
Handeln) von Einzelindividuen und/oder Gruppen untersucht wurde, um aus diesem
Handeln eine für den Teilbereich gültige Theorie abzuleiten. Nein, Luhmann
stellte den höchstmöglichen Anspruch, nämlich den die
gesamte (Welt-)Gesellschaft und alle in ihr vorkommenden Handlungen von
Einzelindividuen und/oder Gruppen erklären zu können.
Selbstverständlich
erregte diese Theorie viel Aufsehen, nicht nur in Soziologenkreisen. Ein so
hoher und umfassender Anspruch musste einfach zur Polarisierung beitragen. Die
Gegner der Systemtheorie versammelten
sich hinter Jürgen Habermas, welcher sich mit der Systemtheorie befasste und sie einer umfassenden Kritik unterzog. So
kam es unter anderem zu einem Briefwechsel zwischen Habermas und Luhmann sowie
etlichen Artikeln in soziologischen Fachzeitschriften. Bekannt geworden ist
dieses Duell als Habermas-Luhhmann-Kontroverse.
1981 verfasste Habermas eine Art Gegenstück zu Luhmanns Systemtheorie, die Theorie des kommunikativen Handelns, die nicht
zuletzt aus der kritischen Beschäftigung mit der Systemtheorie Luhmanns entstanden war. Habermas erhob jedoch ausdrücklich
nicht den Anspruch, eine gesamtgesellschaftliche Theorie entwickelt zu
haben.
Ich möchte
nun zunächst einige wenige Grundzüge der Systemtheorie
von Luhmann wiedergeben: Nach Luhmann besteht die Welt aus Systemen. Wir können uns niemals von allen Systemen gleichzeitig
klar abgrenzen oder gar ihre Existenz verdrängen. Wenn ich am Straßenverkehr
teilnehme - und sei es auch nur als Fußgänger - so nehme ich am Straßenverkehrssystem
teil. Sollte ich dabei verletzt werden, so ist das Rechtssystem
für die Klärung der finanziellen Belange der am Unfall Beteiligten zuständig.
Sollte sich ein Krankenhausaufenthalt nicht vermeiden lassen, so kommt mir die
Rolle des Patienten zu und ich werde vorübergehend Teil des Gesundheitssystems.
Wir sind immer Teil mindestens eines Systems und grenzen uns dadurch von anderen
Systemen ab. Wenn ich beispielsweise verletzt im Krankenhaus liege und als
Patient Teil des Gesundheitssystems bin,
kann ich nicht gleichzeitig Teil des Straßenverkehrssystems
sein. Allerdings kann ich, indem ich beispielsweise in der Krankenhauskantine
etwas essen gehe, Teil eines Subsystemes der Wirtschaft sein, wenn auch nur für
vorübergehende Zeit, ohne aus dem Gesundheitssystem
und der Rolle als Patient auszuscheiden.
In dem System
bzw. in den Systemen in denen ich mich jeweils befinde gelten bestimmte Regeln,
von Luhmann Codes genannt. Diese System
- Codes sind es, die den Gang der Interaktionen und das Handeln der
jeweiligen Systemteile (der Menschen) bestimmen. Diese System - Codes bestimmen auch, welche Handlungen anschlussfähig
sind und welche nicht. Nicht-anschlussfähig
sind Handlungen, die den System -
Codes zuwiderlaufen. Auf diese Handlungen kann nicht so reagiert werden, das
es zu einer Zufriedenstellung aller Interaktionspartner kommt. Diese Handlungen
führen meist zum Abbruch der Interaktion. Ich kann mich schwerlich in einer
Bank nach frischen Brötchen erkundigen, mein Auto vom Bäcker waschen lassen
wollen oder von einer Krankenschwester verlangen, den ganzen Tag mit mir
Backgammon zu spielen. Solche Handlungen stellen nicht-anschlussfähige
Handlungen dar. Der Schalterbeamte wird mich daher freundlichst zum Ausgang
begleiten, der Bäcker mir vielleicht ein frisches Brötchen anbieten um im Kopf
wieder klar zu werden und die Krankenschwester wird den Kopf schütteln, was man
in ihrem Beruf so alles erleben kann. Nach Luhmann gehen nicht-anschlussfähige Handlungen "als Rauschen am System
vorbei". Sie werden nicht in ihrer Substanz wahrgenommen, sondern nur als das
jeweilige System nicht beeinflussende Hintergrundgeräusche.
Der
Schalterbeamte, der Bäcker, die Krankenschwester - sie sind alle Teile eines Systems und haben daher zu funktionieren.
Sie sind Funktionsträger und tragen -
wie jeweils viele andere Funktionsträger -
ihren Teil dazu bei, das das jeweilige
System reibungslos funktioniert. Luhmann bestreitet allerdings nicht, das
sich die Funktionsträger der Systeme auch
eigene kritische Gedanken bezüglich des jeweiligen Systems machen können. Er
nennt das das eigene psychische Programm oder
besser das psychische Programm Mensch.
Jedoch steht dies in den allermeisten Fällen hinter dem Erfüllen des Funktionstägertums zurück, da eine Mißachtung der System
- Codes mit Ausgrenzung durch die anderen
Systemteilnehmer geächtet wird. Es ist zum Beispiel durchaus möglich, das
die Krankenschwester den Gedanken, den ganzen Tag mit mir oder einem
anderen Patienten Backgammon zu spielen, sehr symphatisch findet. Doch sie wird
ihren Gedanken höchstwahrscheinlich nicht in die Tat umsetzen und stattdessen
ihre Funktion als Krankenschwester erfüllen,
weil das ansonsten nicht unmittelbar aber sehr bald den Verlust des
Arbeitsplatzes zufolge hätte. Daher gilt meist (Zitat Luhmann):"Die
Minister regieren, die Soldaten marschieren, die Schreiber protokollieren - ob
es Ihnen nun passt oder nicht."
Es ist
allerdings nach Luhmann durchaus möglich, System-Codes
(und damit das jeweilige System)
ganz oder teilweise zu verändern. Systeme
sind zwar sehr komplex, aber nicht unflexibel und die System - Codes sind nicht für alle Zeiten starr festgeschrieben. Zu
ihrer Veränderung benötigt man allerdings eine ganze Reihe von Funktionsträgern,
die eine Veränderung herbeiführen wollen.
Eine wie ich
finde sehr treffende Geschichte, die mir vor ein paar Monaten eine Ärztin erzählt
hat, soll hier als Beispiel dienen.Während ihrer sechsmonatigen
(vorgeschriebenen) Praktikantinenausbildung vor 15 Jahren erhielt sie monatlich
250 DM netto - so wie alle Praktikanten des Krankenhauses, in welchem sie die
Ausbildung absolvierte, 40 an der Zahl. Für diesen Lohn mussten die
Praktikanten hauptsächlich säuberungstechnische
Arbeiten übernehmen, also Spritzen säubern, Erbrochenes wegwischen, Böden
blank wienern etc. Ihre Arbeitskleidung (Kittel, Schuhe) mussten sie zudem
selbst kaufen und säubern. Aber immerhin bekamen sie in der Kantine gratis
Mittagessen. Nach zwei Monaten strich der Krankenhausdirektor den Praktikanten
dieses Privileg mit der Begründung, sie seien schließlich nur Angestellte auf
Zeit und würden enorme Kosten verursachen. Obwohl alle Praktikanten auf ein
gutes Arbeitszeugnis nach 6 Monaten angewiesen waren, kam es nun zum Streik. Die
Praktikanten versammelten sich im Ruheraum des obersten Stockwerkes des
Krankenhauses und arbeiteten nicht mehr weiter. Der Direktor kam zu Ihnen herauf
und erklärte, ohne sich die Forderungen der Gruppe anhören zu wollen, sie hätten
kein Streikrecht und sie sollten weiterarbeiten. Daraufhin erklärte die Gruppe
einstimmig, man sei gerne bereit sich einsperren zu lassen, da man ja ohne
Streikrecht streike. Aber dieses Vorgehen würde an den Forderungen, die man hätte
und vortragen wolle, nichts ändern. Drei weitere Tage später gab der Direktor
nach und erfüllte die Forderungen der Praktikanten nach gestellter
Arbeitskleidung und Wiedereinführung des gratis Mittagessens. Das Krankenhaus
befand sich hygienisch in einem bereits sehr unangenehmen Zustand und die
Beschwerden der Patienten häuften sich, da schien die Erfüllung der
Praktikantenforderung dem Direktor ein geringes Übel, so das ein
entsprechender Passus bezüglich der zwei erhobenen Forderungen in die
Arbeitsverträge eingearbeitet wurde.
Luhmann
allerdings mochte nicht bewerten, ob eine Irritation
des jeweiligen Systems gut oder schlecht sei - auch im Einzelfall wollte er
dies nicht tun. Sein Augenmerk lag
auf der Beschreibung und Erklärung von
Systemen und damit der (Welt-) Gesellschaft.
Jürgen
Habermas warf Luhmann daher einen fehlenden
moralischen Anspruch vor. Luhmann könne ja wunderbar beschreiben und erklären,
wie zum Beispiel Organisierte
Wirtschaftskriminalität funktioniere, aber er urteile nicht darüber und
ziehe daher aus seinen Beschreibungen und Erklärungen keine moralische Konsequenz. Genau dies sei aber notwendig und
erforderlich in einer Demokratie, denn schließlich strebe jede demokratische
Gesellschaft nach dem Ideal, möglichst vielen Menschen ein optimales Leben zu
ermöglichen. Und was das sei, ein optimales
Leben, darum müsse gestritten werden. Wie aber streiten ohne Verwendung der
eigenen Urteilskraft? Luhmann mache es sich zu einfach. Würde man
beispielsweise über Mädchenhandel sprechen als ausdifferenziertes Subsystem des Systems "Organisierte Kriminalität",
so reiche es eben nicht aus, nur zu beschreiben und zu erklären. Eine moralische
Ächtung sei hier von Nöten und eine Perspektive,
wie man zur Unterbindung solcher Praktiken käme. Genau diese liefere Luhmann
aber nicht und daher würde seine von ihm selbst so bezeichnete Vogelperspektive
eher einem Elfenbeinturm gleichen.
Weiterhin
besteht laut Habermas eine Gesellschaft zwar auch, aber nicht nur aus Systemen. Das, was eine demokratische Gesellschaft zusammenhält,
sollten Werte sein. Werte wie Freiheit,
Gleichheit, Gerechtigkeit zum Beispiel. Diese Werte gelte es zu erhalten.
Dies sei jedoch nur möglich, wenn die Gesellschaft einen ihr eigenen moralischen Wertekodex entwickle und dazu müsse nun
einmal geurteilt werden. Doch blinde
Funktionsträger können nicht urteilen. Um verkürzt mit Luhmann zu
sprechen: Die regieren, die marschieren, die protokollieren - ob es ihnen paßt
oder nicht. Besonders gegen den letzten Teil des Satzes wehrt sich Habermas,
sieht seinen Inhalt gar als Gefahr für die Demokratie. Denn ein freiheitlicher
demokratischer Rechtsstaat könne sich nur entwickeln, wenn es "einen
unverzerrten Diskurs unter Gleichen gebe". Nicht kraft des eigenen Amtes,
sondern kraft des besseren Argumentes, gleich von wem es kommt, sollten
Entscheidungen getroffen werden.
Dies solle so sein, und man müsse die Entwicklung dahin befördern, das
es so werde.
Doch dieser
Beförderung der Entwicklung stehe die Systemtheorie
Luhmanns eindeutig im Wege, da sie den Menschen zu einem fast
blinden Funktionsträger degradiere und ihm jegliche moralische
Urteilskraft abspreche.
Zu all diesen
Punkten muss man wissen, das Luhmann sich zeitlebens gegen das
Moralisieren wendete und sagte: "Die Systemtheorie erhebt nicht den
Anspruch, moralische Maßstäbe zu setzen. Sie will beschreiben und erklären.
Und in diesem Sinne ist sie umfassend. Somit warf also Habermas Luhmann vor, bei
ihm fehle genau der moralische Anspruch,
den Luhmann vehement als "nicht zur Systemtheorie
gehörig" ablehnte.
Zurück | Weiter | Kritisieren & Diskutieren | Mail | About Mirko