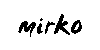
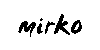
8. Für die, die mit dem Feuer spielten
Auffällig an der Antisemitismus-Debatte um den Tod
eines Kritikers war vor allem das, was die Berliner Morgenpost am 5. Juni
2002 als Stellvertreter-Syndrom beschrieb. "Im Walser-Skandal aber
zeigt sich, dass die Attitüde des Priesterlichen nicht der Vergangenheit angehört.
Eingeweihte mit exklusivem Textzugang deuten aus, präsentieren Zitate und
"Stellen" und nehmen qua Amt für sich in Anspruch, stellvertretend für die
Gemeinde zu lesen, zu interpretieren und zu urteilen. Die Frage ist allerdings,
ob die Gemeinde dieses Stellvertretertum akzeptiert. Der Streit um Walsers Tod
eines Kritikers lässt sich auch beschreiben als Zerfall medialer Öffentlichkeit.
Die Akteure dieses Streits bewegen sich in einem selbstreferentiellen Zirkel.
Sie kreisen umeinander und beschäftigen sich mit sich selbst und demonstrieren
die Macht der Loyalitäten, die sie jeweils ins Feld führen können."
Diese selbstreferentielle Medien-Debatte um das Buch
und das Thema dieser Debatte führten das Buch, als es dann erschien, sofort auf
Platz 1 der Bestsellerliste. Mittlerweile hat sich der Hype gelegt und es ist
vielleicht reizvoll eine Bilanz der Antisemitismus-Debatte um den Tod eines
Kritikers zu ziehen. In den Mittelpunkt stelle ich die Frage nach dem
antisemitischen Gehalt des Buches.
Walser kann, da hat er recht, nichts für die Herkunft
und Identität des von ihm angegriffenen Marcel Reich-Ranicki. Und – auch da
hat er recht – es muss auch in Deutschland möglich sein einen jeden Menschen
zu kritisieren, wenn sein Verhalten dazu Anlass bietet.
Kritisiert man einen Menschen, weil er Jude ist (oder
erklärt seine negativen Eigenschaften zu jüdischen Stereotypen), dann nennt
man das Antisemitismus. Kritisiert man einen Menschen einzig und allein
wegen eines bestimmten Verhaltens, unabhängig davon ob er Jude ist und ohne zu
Stereotypisierungen zu greifen, dann ist das kein Antisemitismus.
Auf Letzteres beruft sich Walser. Er hat den Kritiker
kritisiert und nicht den Juden, so meint er. Doch schon beim ersten Vorwurf an
seine Darstellung im Buch wird es knifflig. Er bediene typische antisemitische
Stereotype, hieß es. So lasse er z.B. das Bild des ewigen Juden wieder
aufleben, zudem das des sexbesessenen, tückischen und raffinierten Fälschers,
der von der Leistung anderer profitiert. Und in der Tat: So stellt Walser
Reich-Ranicki dar. Die Frage ist nur, ob er diese Stereotype dabei im Sinn
hatte. Und hier beginnt die Spekulation, die letztlich nur schwerlich zu einem
Ergebnis führt.
Die Einen sagen: Ist doch klar. Walser hat die
Eigenschaften Marcel Reich-Ranickis aus gängigen antisemitischen Klischees
abgeleitet. Die Anderen sagen: Was kann Walser dafür, dass MRR gewisse
Eigenschaften hat, die antisemitischen Klischees entsprechen. Die ständige Präsenz
Marcel Reich-Ranickis im literarischen Leben z.B. ist doch nicht zu leugnen.
Walser hat nur Marcel Reich-Ranicki überzeichnet dargestellt, er hat seine
Eigenschaften nicht zu typisch jüdischen erhoben. Aufbauend auf diesen
Grundpositionen kann man eine ellenlange Debatte führen. Sie wird besser
entscheidbar durch die Beantwortung der Frage für wie realistisch man die
Darstellung MRR's hält. Je mehr sich Walser an der realen Persönlichkeit
orientiert hat, desto weniger kann man ihm Antisemitismus vorwerfen. Wobei denn
immer noch die Frage bleibt, wie sehr Walser diese Persönlichkeit, wissend um
antisemitische Klischees, überzeichnen durfte.
Gewundert hat mich allerdings die Überraschung Martin
Walsers, als die Antisemitismusvorwürfe aufkamen. Er selbst antizipiert diese
Vorwürfe doch schon im Roman selber. Kurz nach Hans Lachs Geständnis heißt
es: "Das Thema war jetzt, dass Hans Lach einen Juden getötet hatte."
[1]
Daraufhin diskutierten die Feuilletons und werfen Hans Lach seinen Hitler-Jargon
vor, als er beim Hinauswurf auf der Party MRR androhte: "Ab heute nacht Null
Uhr wird zurückgeschlagen."
[2]
Diese Vorwürfe werden von einem gewissen Wolfgang Leder zurückgewiesen. Zudem
ist die Quelle des Zitates dubios. Es ist die FAZ, aber von den Partygästen die
Michael Landolf befragt, kann sich keiner an das Zitat erinnern. Dies hat auf
mich sehr präventiv gewirkt, so als hätte Walser die Vorwürfe, die da kommen
könnten, antizipiert. Letztlich geht es bei der Diskussion, die Walser erwähnt,
um einen möglichen antisemitischen Hintergrund der Tat, den die Feuilletons zu
beweisen versuchen, indem sie eine dubiose Quelle zitieren. Dieses Vorgehen der
Feuilletons ist sehr fragwürdig und wird – in der Person von Wolfgang Leder
– zurückgewiesen. Das alles klingt so wie: Seht her, ich habe kein
antisemitisches Motiv. Auch wenn ihr mir eines werdet anhängen wollen.
Nebenbei sei noch angemerkt, dass Walser sich auch
nicht allzu sehr über die Absage der FAZ bezüglich des Vorabdrucks zu wundern
brauchte. Schließlich kommt sie als dubiose Quelle eines solchen Zitates extrem
schlecht weg. Nun aber noch zu den Geschmacklosigkeiten des Romans, die auf
jeden Fall zum Vorwurf als Antisemitismus gegenüber Walser berechtigen. Walser
lässt nämlich, wenn er den Menschen MRR angreift, oftmals Anstand und
Menschenwürde vermissen. Bei aller Sehnsucht nach Normalität im Umgang
mit unserer Geschichte (was das sein soll und wie das aussehen sollte, wüsste
ich mal gern) kann Walser, wenn er schon den Menschen MRR über seine Rolle als
Kritiker hinaus angreift, nicht einfach im biographisch Voraussetzungslosen
ansetzen. Da heißt es: "So bin ich in meinem ganzen Leben noch nie beleidigt
worden, hat Ehrl-König in Stuttgart dem Veranstalter in's Gesicht gebrüllt,
weil der versäumt hatte, Ehrl-König in Stuttgart mit dem Taxi vom Hotel
abzuholen, so dass Ehrl-König selber den Portier am Empfang bitten musste, ein
Taxi zu bestellen. Da beginnt man zu ahnen, was dieser Mann gelitten hat in
seinem Leben."
[3]
Oder: "Umgebracht zu werden passt doch nicht zu André
Ehrl-König"
[4]
Solche Passagen sind einfach nur unterste Schublade. Wie soll man das lesen,
ohne es für Hohn und Spott gegenüber der Biographie Reich-Ranickis zu halten?
Der Roman hat einige antisemitische und sehr viele in
diese Richtung tendierende, fragwürdige Stellen, die Raum zum Spekulieren
lassen. Wer aber diesen Raum lässt, darf sich auch über unangenehme
Spekulationen und heiße Debatten nicht wundern. So wie Walser haben auch die
Medien mit dem Feuer gespielt, die den großen Skandal inszenierten, allen voran
Frank Schirrmacher, dessen öffentliche Absage das Spektakel zusätzlich
anheizte. Sie waren nur noch für sich und ihre Machtspielchen da und benutzten
dazu das Thema Antisemitismus, welches eine wesentlich seriösere
Diskussion unter Einbeziehung des (literarischen) Publikums verdient gehabt hätte.
Und auch Marcel Reich Ranickis unglückliche Forderung, das Buch solle
erscheinen, aber nicht im Suhrkamp-Verlag, war nicht hilfreich. Das lies die
Debatte um die Veröffentlichung des Buches vollends zu einer Machtfrage im
Literaturbetrieb werden.
Fazit: Alle Beteiligten, vor allem große Teil der Medien und Martin
Walser haben sich kräftig verbrannt beim Spiel mit dem Feuer. Moralisch
gesehen. Ihren Auflagen hat es nicht geschadet. Das ist das eigentlich
Tragische. Warten wir also bis zur nächsten Hysterie. Wer auch immer sie auslöst.
Zurück | Kritisieren & Diskutieren | Mail | About Mirko
____________________
[1] Martin Walser: Tod eines Kritikers. S. 144
[2] Martin Walser: Tod eines Kritikers. S. 48
[3] Martin Walser: Tod eines Kritikers. S. 148
[4] Martin Walser: Tod eines Kritikers. S. 183