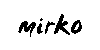
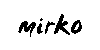
Verschiedenes
Ein weiterer frappierender
Schreibfehler, wenn ich denn Recht haben sollte, ist mir auf der 2. Seite auch
noch aufgefallen. Du schreibst, nachdem du über diejenigen gegeißelt hast, die
sich nicht die Schwierigkeit einer textimmanenten Deutung machen: Spätestens hier scheidet sich dann die Liebe, die jeder für Kafka übrig
hat, in gedankenlosen Genuß und den Willen die Herausforderung des
Textes anzunehmen. Statt und
muss da ohne stehen, so meine
ich, denn diejenigen, über die du sprachst, haben ja gerade den Willen nicht,
die Herausforderung des Textes anzunehmen. Aber du nimmst sie an und stellst dem
Leser nun die Fragen vor, die du dir gestellt hast, nach denen du dein Essay
ausgerichtet hast, was mir sehr gut gefallen hat, denn so weiß der Leser, woran
er dich messen kann, welche Fragen du dir zu beantworten zur Aufgabe gemacht
hast.
Kleine Kritik am Rande: Die letzte
Frage, nämlich Was hat es zu bedeuten,
das es für den Mann vom Land quasi einen Privateingang zum Gesetz gibt?
hast du nur unzureichend beantwortet. In dem Kapitel Freiheit,
Entfremdung und Sinnverlust findet sich zwar unten auf Seite 8 einige Sätze,
jedoch wird die Frage nach dem Privateingang
nicht beantwortet, und auch das Gleichnis Vor dem Gesetz wird nur unzureichend behandelt. (Kritik an Robert und
mich: Wir haben uns überhaupt nicht daran gewagt, obwohl es mir, gerade da es
am Ende des Romans auftaucht, von zentraler Bedeutung für das Verständnis des
Romans zu sein scheint.)
Die Darstellung der etymologischen
Korrespondenz zwischen Hiob und
dem Prozeß ist dir bis auf
Kleinigkeiten sehr gut gelungen. In der Tat erkenne ich in jeder Zeile Hiobs
erster Rede den Prozeß und seine
Themen wieder. Jedoch nicht den Anwalt,
falls du damit Josef K"s Advokaten gemeint hast. Dieser ist in Hiobs erster Rede weit und breit nicht zu entdecken.
Die Behauptung einer Vermischung von Pantheismus und Atheismus im Prozeß scheint mir valide zu sein,
auch weil die Bedrohung der ständig präsenten Organisation im Prozeß
teilweise von K. geleugnet wird (Aber
auch das muss sie nicht kränken, wenn Sie bedenken, daß mir am Ausgang des
Prozesses gar nichts liegt und daß ich über eine Verurteilung nur lachen
werde, S.62, Zeile 26-27, es gibt weitere Textstellen, die dies belegen,
massenhaft zu finden im Zweiten Kapitel Erste
Untersuchung) und man dann den Eindruck hat, das Gericht könne ihm nichts
anhaben und er handle in völliger Souveränität, andererseits K"s
Ermattung ständig voranschreitet und er resigniert feststellen muss, daß ja
alles zum Gericht gehöre (Es gehört ja
alles zum Gericht, Seite 158). Zum einen leugnet K. die Situation des öfteren,
handelt in einem Hochgefühl, in dem er sich gar zu Spötteleien hinreißen läßt
(hier erkenne ich den Atheismus wieder)
und zum anderen muss er resignierend die Allgegenwart des Gerichtes feststellen,
seine Omnipräsenz (Hinweis auf den Pantheismus).
Auch der Mut, sich zu wehren und die Unmöglichkeit, die eigene Unschuld zu
beweisen, sind richtig erkannt, die restliche etymologische Korrespondenz des Kapitels Hiob ist über jede Kritik erhaben, wie ich meine.
Nun zum Kapitel Theodizee:
Die Klage K"s ist für mich eine Ungereimtheit und nicht ganz
nachvollziehbar. Wo findet eigentlich die Jagd statt, auf die mit der Göttin
der Jagd angespielt wird.
Die Organisation, von der im Prozeß die Rede ist, bleibt bis zum Schluß nicht greifbar und eher
ist es K., der beständig den Gang der Handlung forciert. Ich sehe darin auch
einen Widerspruch zu einer von dir aufgestellten zutreffenden Behauptung. Zitat:
Es sind - korrespondierend dazu -auch eher Passivität und Gleichgültigkeit,
die das Gericht kennzeichen - und nicht Mißgunst (Seite 6, unterer Teil).
So ist es. Wie läßt sich das - diese Frage möchte ich hiermit aufwerfen - mit
der Jagd vereinbaren, auf die angespielt wird. Eine Deutung hätte ich auch
schon parat, bin mir aber ihrer unsicher: Man könnte hier den Begriff Jagd
anders deuten als im herkömmlichen Sinn, etwa so wie eine Jagd mit unendlichem Atem des Jägers, welcher deshalb,
aufgrund seiner Übermacht, auch nicht schnell und brutal vorgehen muss, oder -
um es zu übertragen: Der Sieg der omnipräsenten Organisation ist nur eine
Frage der Zeit und deshalb kann sie es sich auch leisten, das K. unbehelligt
bleibt, das er frei bleibt - weil alle seine Unterfangen aufgrund seiner
prinzipiellen Schuld sinnlos sind und sein werden, und weil er die Beute sein
wird - mit hundertprozentiger Sicherheit.
Die Theodizeefrage,
die du ins Spiel gebracht hast, ist wahrscheinlich eine der spekulativsten überhaupt,
auf keinen Fall endgültig lösbar, da müssen wir schon warten bis zum Tag
des Jüngsten Gerichts, was mich nicht hindern soll, meine eigene kleine
bescheidene Deutung zum Besten zu geben, die natürlich auch nichts weiter ist
als ein fragmentarisch zusammen gezimmerter Glaube, jedoch einen Aufhänger für
eine Diskussion durchaus bieten kann: Ich lehne mich an an die von dir bereits
gegebene Antwortmöglichkeit (Seite 7, oben) und baue sie dahingehend aus, das
ich das Gute und das Böse weiter
differenzieren möchte. Ich glaube an eine individuelle Bewerung jedes einzelnen
Menschen durch ein nachweltliches Gericht, welches seine Lebensumstände extrem
berücksichtigt. Nach diesem Glauben müssen die Taten eines palästinensischen
Kindes, welches von seinem radikalen Vater lernte (ich verwahre mich bei diesem
Beispiel und auch bei dem folgenden gegen jede eventuelle Verallgemeinerung),
das es das Beste sei für die Palästinenser zu sterben durch ein
Selbstmordattentat und andere mit in den Tod zu nehmen ganz anders beurteilt
werden wie ein 55jähriger Amokläufer, der aufgrund einer privaten Tragödie
zur Furie wurde und um sich schoß. Ich weiß, dieses Beispiel ist sehr simpel
und schreit deshalb nach Kritik und dennoch glaube ich, das für jeden Menschen
nach seinem Tode individuelle Kriterien von gut
und böse angelegt werden, denn nur so ist eine gerechte Bewertung eines
jeden Individuums möglich. Natürlich habe ich die Frage damit keinesfalls
umfassend beantwortet, habe aber, wenn jemand möchte, vielleicht den Anstoß zu
einer Diskussion gegeben und einen Ansatz geboten, der dem Glauben, das die Macht
Gottes und das Recht Gottes eins sind, gehörig widerstrebt (ohne leugnen zu
wollen, das man aus dem Prozeß eine
solche Schilderung herauslesen und eine solche Kennzeichnung treffen kann, wie
du es getan hast).
Zu dem eher marginalen
Apfel-Beispiel bezüglich des Sündenfalls
ist mir folgende Korrespondenz eingefallen: Stirbt Gregor Samsa in Die
Verwandlung nicht durch einen Apfelwurf?
Ich meine, mich so erinnern zu können. Wäre interessant zu untersuchen,
inwieweit dort Parallelen vorhanden sind.
Bei Lenis Zitat ist mir ein weiterer
Widerspruch aufgefallen, und zwar das im Prozeß
niemals die Rede davon ist, daß man durch ein Geständnis,
oder besser durch ständige Geständnisse (die Beichte ist ja kein einmaliger
Akt) die Absolution erhalten kann. Dann hätte die Analogie zum
christlich-orthodoxen Sakrament der Beichte noch besser gepaßt, da dann die Möglichkeit
der Errettung und der Loslösung von der eigenen Schuld, die sich glaube ich
auch im Alten Testament findet (habe hier keine Bibel und bin alles andere als
bibelfest, da müsste mir mal jemand auf die Sprünge helfen) thematisiert
worden wäre.
Skeptizismus,
der: Standpunkt grundsätzlichen Zweifels: im Extremfall Verneinung der
Erkenntnismöglichkeit von Wahrheit, Wirklichkeit und allgemein gültigen
Normen. Zu diesem Skeptizismus bleibt mir nur zu sagen, das du ihn bei Kafka
treffend identifiziert hast, da letztlich sich wirklich jede Andeutung, das K.
zu wahrer Erkenntnis gelangen könne, sich als Schein herausstellt und auch
keine der Personen, welche er im Verlaufe des Prozesses trifft, zu wahrer Erkenntnis gelangt ist, die
weiterzugeben und entscheidend zu helfen ein leichtes wäre.
Den Gefängniskaplan als Erzähler des
Gleichnisses Vor dem Gesetz möchte
ich hier jedoch etwas ausnehmen, da bei ihm stärker als bei jeder anderen
Person angedeutet wird, das er mehr weiß, als er sagt ("Siehst
du denn nicht zwei Schritte weit?" Es war im Zorn geschrien,
aber gleichzeitig wie von einem, der jemanden fallen sieht und, weil er selbst
erschrocken ist, unvorsichtig, ohne Willen schreit? S.228 oder: Warum
sollte ich also etwas von dir wollen. Das Gericht will nichts von dir. Es nimmt
dich auf, wenn du kommst, und es entläßt dich, wenn du gehst.")
Nicht verstanden habe ich deine
Folgerung zum 30.Geburtstag. Was hat der 30.Geburtstag mit hermetischem Eingeschlossensein zu tun. Ich gebe zu, das ich die
erste Hälfte der 9. Seite nicht verstanden habe, könntest du das noch einmal
etwas einfacher darstellen?
Deinen letzten Schlüssen stimme ich
dann wieder fast uneingeschränkt zu, wobei noch anzufügen wäre, das es ja
durchaus Legenden von Freisprüchen gibt,
von denen man sich fragen müsste, wie sie zustande gekommen sind, obwohl kein
Streit über ihre Notwendigkeit bestehen kann, da auch diese Legenden
dem Glauben an eine Loslösung der Schuld Nahrung geben können - und das
nicht zu knapp.
Gesamturteil: Obwohl ich mich wiederhole - ein insgesamt gutes Essay deinerseits, welches nun hoffentlich zu einer lebhaften Diskussion beiträgt. Ich glaube, du hast erst mal Maßstäbe gesetzt. Ein Anreiz für Robert, Ricarda, Tanja, Sarah und mich beim nächsten Mal, so denke ich.
Zurück | Kritisieren & Diskutieren | Mail | About Mirko