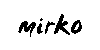
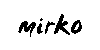
Der
Proceß als Spiegel Freudscher Persönlichkeitskonflikte
–
Schon deinem
ersten Gedankengang stehe ich skeptisch gegenüber. Natürlich ist die
phasenweise vorhandene surreale Atmosphäre
des Buches nicht von der Hand zu weisen. Doch der Plot enthält, wie du
selber sagst, viele realitätsbezogene
Aspekte. Diese realitätsbezogenen
Aspekte sind beileibe nicht nur für einen Traum typisch und sie sind sogar
stark genug um K. glauben zu machen, er befinde sich in seiner Alltagswelt. Die
phasenweise vorhandene surreale Atmosphäre
eines Gedichtes, einer Novelle, eines Romans müssen nicht zwingend den
Schluss nach sich ziehen, das geschilderte Geschehen spiele sich in einer
imaginierten Traumwelt ab. Beispielsweise erschien mir der Roman Der
Garten Eden von Ernest Hemingway auch in einigen Passagen höchst surreal,
doch lässt die Handlung diesen Schluss ganz und gar nicht valide erscheinen.
Auch Kafkas Erzählungen Auf der Galerie
oder Die Verwandlung müssten demnach
in einer Traumwelt spielen. Die Kunst von Literatur ist es jedoch - und das will
ich dir von meinem persönlichen Standpunkt aus entgegenhalten - nicht gleichförmig
ein Geschehen zu schildern, sondern das geschilderte Geschehen besonders
erscheinen zu lassen, erzählenswert nämlich. Dazu ist es notwendig, von
klischeehaft verbreiteten Vorstellungen abzurücken. Die Wahl der Mittel steht
dem Autor zur Verfügung. Sobald er sich Mitteln bedient, welche phasenweise
eine surreale Atmosphäre schaffen,
nun gleich auf eine imaginierte Traumwelt zu schließen, ist zumindest fragwürdig,
denn ebenso valide wäre es zu behaupten, das der Autor nur von klischeehaft
verbreiteten Vorstellungen abweichen wollte, um ein erzählenswertes Geschehen
zu schaffen und/oder das die starke Abweichung von eben diesen Vorstellungen
deshalb so stark ist, damit sie ins Auge springt und der Leser Rückdeutungen
auf die eigene Alltagswelt vornimmt.
Doch abgesehen von diesem meinem - vielleicht nur marginalen - persönlichen Standpunkt, habe ich auch einen logischen Widerspruch entdeckt. Wie kann beispielsweise das Geschehen in einer Traumwelt spielen, in der die Gesetze der Logik und Konvention außer Kraft gesetzt sind, obwohl die realitätsbezogenen Aspekte des Geschehens so stark sind? Ergeben die realitätsbezogenen Aspekte sich nicht aus dem Zusammenspiel von Logik und Konvention?
Ferner: Was
ist eine metaphysische Sinnkrise?
Damit kann ich gar nichts anfangen.
Warum ist der
dreißigste Geburtstag ein Bruch, und
als solcher geradezu prädestiniert für
metaphysische Sinnkrisen? Du hast in diesem Zusammenhag von Empirie
gesprochen. Auf welche empirischen Ergebnisse stützt du dich bei dieser
Behauptung?
Was ist eine Nahtoderfahrung?
Ich habe eine laienhafte Vorstellung (eine Berührung/Ahnung des eigenen
Todes?), doch eigentlich kann ich auch mit diesem Begriff nichts anfangen.
Auch mit der imaginierten
Gerichtssituation durch sein (K"s)
Unbewusstes habe ich so meine Schwierigkeiten. Natürlich ist dieser Schluss
möglich, jedoch ist er faktisch nicht nachweisbar. Diese Kritik soll generell für
dein gesamtes Essay gelten. Da du nicht nachweisen kannst, das K. die
Gerichtssituation durch sein Unbewusstes heraufbeschwört
(dies ist keine Kritik an deiner Person, sondern ich will auf die Unmöglichkeit
hinweisen, das Unbewusste faktisch
greifbar zu machen), kehrt sich die Beweislast um und ich muss nachweisen,
sofern ich mich nicht an der Spekulation beteiligen will, das es nicht so ist.
Dies kann ich natürlich genauso wenig. Denn eine Argumentation, die sich auf
das Unbewusste stützt, ist immun
gegen jede Kritik außer gegen die, das die Kennzeichnung und Erfassung des Unbewussten
ein sehr gewagter Akt ist und in seinem Wesen spekulativ sein muss. Mich hat
deine Behauptung bezüglich des Unbewussten
stark an die Kritik erinnert, die ich nach wie vor an die Theorie des Rational Choice richte. Ein einfaches, aber treffendes Beispiel: Ein
Mann steht vor der Wahl, ein illegales Handels-Geschäft abzuschließen, das ihm
viel Geld, oder, wenn es schief geht, viel Ärger mit der Justiz einbringen
wird.
Fall 1: Er
schließt das Geschäft ab. Was war das dann? Ganz klar, eine rationale
Wahlhandlung. Die Werte (viel Geld) überstiegen für den Mann die Kosten
(eventueller Ärger mit der Justiz).
Fall 2: Er
schließt das Geschäft nicht ab. Was war denn das dann? Ganz klar, eine
rationale Wahlhandlung. Erste Werte (auf keinen Fall Ärger mit der Justiz) überstiegen
für den Mann die letzteren Werte (viel Geld).
So ähnlich
ging es mir bei deiner Behauptung auch. Das Unbewusste
heranzuziehen ist meiner Meinung nach wie das Sprechen über Alles oder
Nichts. Es findet keine Spezifizierung statt, die falsifizierbar wäre. Das
Gleiche trifft für die Theorie Freuds zu, welche du in Kurzform wiedergegeben
hast. Auch sie ist nicht falsifizierbar und ist im Nachhinein immer anwendbar.
Da ich mich
aus den genannten Gründen außerstande sah, Kritik an deinem Ansatz zu
formulieren, habe ich mir dann einfach gedacht, das ich mich auf deine
Spekulation einlasse und deinen Ansatz akzeptiere, um dann zu prüfen, inwieweit
er und die sich aus ihm ergebenden Gedankengänge dem Buch gerecht werden.
Hier meine
Ergebnisse: Du schreibst, das K"s Ablehnung bestimmter Triebe so stark ist,
das er sie nicht nur auf andere
projiziert, sondern sogar die Anderen zum Zwecke der Projektion erschafft.
Welche Triebe
lehnt K. so stark ab? Kennzeichne sie bitte mal. Die 4 von dir in der
Darstellung von Freuds Theorie benannten Triebe Sex,
Aggression, Hunger und Selbsterhaltung kann ich im Buche bei den anderen
Personen nur am Rande entdecken. Natürlich kann der Ausbruch des Geistlichen im
Dom ("Siehst du denn nicht zwei
Schritte weit") als Aggression gewertet werden, die K. wiederum
ablehnt, weshalb er den Geistlichen erschaffen hat zum Zwecke der Projektion
seiner Ablehnung. Aber ist dafür die Parabel Vor
dem Gesetz notwendig? Ist es dafür notwendig, den Geistlichen über Sinn
und Unsinn der Parabel und des Gerichtes sprechen zu lassen? Ich finde, du
unterschlägst in deiner Deutung, da du sie auf K"s Selbst einschränkst,
einige wichtige Aspekte.
Das
machtvolle Über-Ich in der repressiven
Gesellschaftsnorm mag ich - korresponierend zu meiner Deutung - schon eher
erkennen, zum Beispiel in der Person des Geistlichen oder in der des Advokaten.
Jedoch ist es natürlich vertrackt von der
Verinnerlichung der gesellschaftlichen Werte und Normen zu sprechen, da auch
diese Werte und Normen schwer greifbar und schwer zu kennzeichnen sind. Diese
Kritik ist auch Selbstkritik, gilt auch für mein Essay.
Wenn du die
Triebe gekennzeichnet hast, die K. so sehr ablehnt, so erledigt sich meine nächste
Frage, nämlich aufgrund welcher unterdrückter Triebe K"s Es
revoltieren sollte? Die Beispiele für Es
und Über-Ich, die du gewählt hast, halte ich übrigens für äußerst dürftig. Vor allem, wenn man sie in
den Kontext des Buches stellt. Fräulein Bürstner als Personifikation der Neugier
zu bezeichnen ist sehr gewagt. Sie interessiert sich später nicht weiter für
K"s Sache, sie verweigert ihm den dargebotenen Handschlag, sie schlägt später
eine Unterredung mit ihm aus und hilft ihm in keinster Weise aus eigenem
Engagement, welches ja meist gerade durch Neugierde geweckt wird. Auch weiß ich
nicht, warum ein sehr großer Wächter gleich fürs Über-Ich stehen muss und
ein Wächter, der ein Frühstück isst, fürs Es.
Verstehe mich
nicht falsch. Das kann alles sein. Aber ich finde, hier offenbart sich ein
weiteres Defizit deines Essays, nämlich der Mangel an Beispielen aus wirklich
bedeutenden Textstellen. Gut, über bedeutend
können wir streiten, aber wenn du schon deine Beispiele aus einer Frühstückssituation
oder einem Gespräch mit der Nachbarin rekrutierst, so muss wenigstens die
Quantität stimmen, um eine einigermaßen überzeugende Validität nachzuweisen.
Die weiteren Schlüsse, welche du gezogen hast, haben mich zwar eher überzeugt
(K. wird sein eigener Richter, weil er nicht den Zweikampf seines Selbst
erkennt, kann mit keinem zusammenarbeiten, verdammt sich selbst), jedoch gelingt
es den Henkern nicht (nur) durch das Auftauchen der Frau, K. zu überwältigen.
Zitat: "Das Fräulein war inzwischen in eine Seitengasse eingebogen, aber
K. konnte sie schon entbehren und überließ sich seinen Begleitern. Alle drei
zogen nun in vollem Einverständnis über eine Brücke im Mondschein, jeder
kleinen Bewegung, die. Machte, gaben die Herren jetzt bereitwillig nach, als er
ein wenig zum Geländer sich wendete, drehten auch sie in ganzer Front
dorthin."
Dies schwächt
wiederum deinen Schluss, an dem ich außerdem nicht nachvollziehen kann, das
sich das Es und das Über-Ich nun anscheinend verselbstständigt haben und dass die
Selbsterkenntnis K"s (Zitat: "Soll
ich nun zeigen, dass nicht einmal der einjährige Prozeß mich belehren konnte?
Soll ich als ein begriffsstutziger Mensch abgehen? Soll man mir nachsagen dürfen,
dass ich am Anfang des Prozesses ihn beenden wollte und jetzt, an seinem Ende,
ihn wieder beginnen will? Ich will nicht, dass man das sagt. Ich bin dankbar,
dass man mir auf diesem Weg diese halbstummen, verständnislosen Herren
mitgegeben hat und dass man es mir überlassen hat, mir selbst das Notwendige zu
sagen?") in deiner Deutung außen vor bleibt.
Zurück | Kritisieren & Diskutieren | Mail | About Mirko